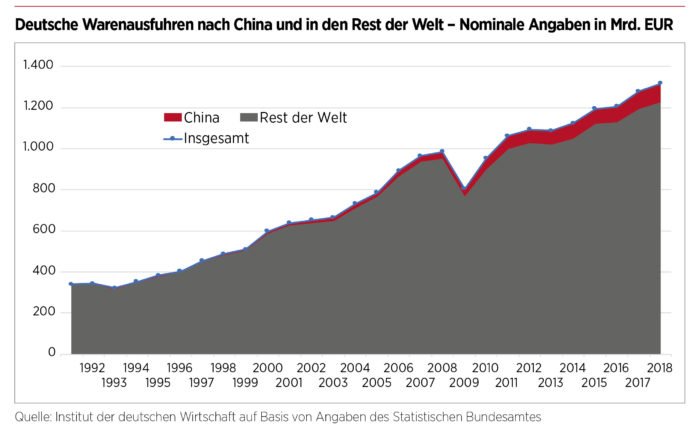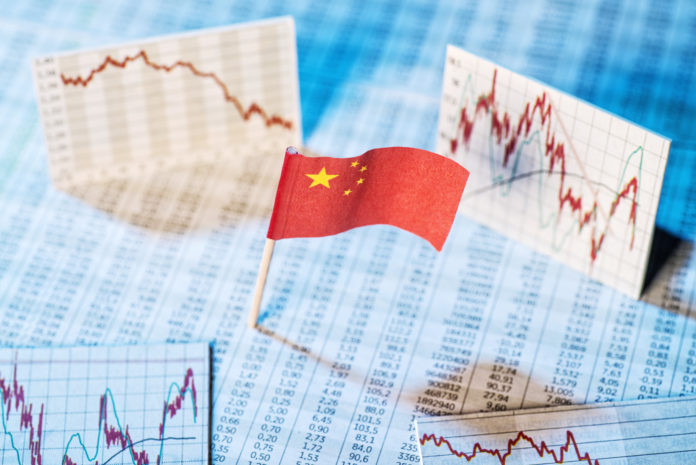Gerade einmal 57 Mrd. USD betrugen die gesamten chinesischen Direktinvestitionen ins Ausland (FDIs) im Jahr 2019, stellt eine Analyse von Baker McKenzie und dem Researchhaus Rhodium fest. In diesem „annus horribilis“ der Auslandsinvestitionen lagen die chinesischen FDIs damit um rund 30% niedriger als im Jahr 2018 und befinden sich nun auf dem tiefsten Stand seit 6 Jahren. Der Rückgang der chinesischen M&A Aktivitäten fand dabei weltweit statt. Bis auf Südamerika konnte sich keine Region dem rückläufigen Trend entziehen. Besonders hart traf es die Europäer und die USA. In die EU flossen gerade einmal 13,4 Mrd. USD, aber damit immerhin noch mehr als doppelt soviel Anlagekapital wie in die USA. Dort investierten die Chinesen nur noch 5,5 Mrd. USD.
Finnland hat die Nase vorn
Damit liegen die chinesischen FDIs in diese beiden Regionen mehr als 80% unter dem Rekordjahr 2017, als aus dem Reich der Mitte 107 Mrd. USD in den „Westen“ flossen. Insgesamt markieren die rund 19 Mrd. für die USA und die EU ein Zehnjahrestief. Dabei konnte Finnland fast genauso viel FDIs anziehen wie die USA – 5,3 Mrd. USD wurden in das kleine Land im hohen Norden Europas investiert. Allerdings entfielen hier alleine 5,2 Mrd. USD auf die Übernahme des Sportausrüsters Amer Sport durch den chinesischen Sportbekleidungshersteller Anta Sport mit Sitz in Jiangjin.
Brexit treibt FDIs
Auf Platz 2 folgt das Vereinigte Königreich. Hier investierten die Chinesen im vergangen Jahr 3,8 Mrd. USD, wobei die Topdeals die zusätzlichen Investitionen der Shangang Group in den Internetdienstleister Globalswitch (2,2 Mrd.) und die Übernahme des Finanzdienstleisters WorldFirst UK durch Alibaba (0,7 Mrd.) waren. Einer der Gründe für das relativ starke Abschneiden der Briten dürfte das Brexit-Geplänkel gewesen sein. Dies führte zu verstärkten Bemühungen um außereuropäische Investitionen. Der nun beschlossenen und zum 31. Januar stattfindenden Brexit sollte diesen Trend noch einmal verstärken. Schweden (1,3 Mrd. USD), Deutschland und Italien (je 0,7 Mrd. USD) folgen dann auf den Plätzen.
Zuwächse in West- und Osteuropa
In relativen Zahlen gab es in Irland einen deutlichen Anstieg. Um rund 50% legten die FDIs hier zu, was in erster Linie auf Greenfield Investments zurückzuführen ist: Unter anderem investierte Wuxi Biologics rund 240 Mio. USD in eine Produktionsstätte für Biologika. Auch Osteuropa verzeichnete starke Zuwächse: Das FDI-Volumen wuchs in Rumänien geradezu explosionsartige auf 238 Mio. USD an. Maßgeblich ist dies auf die Übernahme vom 15 Getreidesilos und Logistikzentren durch CEE Equity Partner, das neue Joint Venture-Unternehmen von CGN mit Nuclearelectrica, und die Übernahme der KLG Europe-Aktiva in Rumänien durch Sinotrans zurückzuführen. Insgesamt hat sich das durchschnittliche Transaktionsvolumen leicht erholt und betrug im Jahr 2019 132 Mio. USD gegenüber 130 Mio. USD im Vorjahr. Damit aber lag es immer noch weit unterhalb des Rekordjahres als das Mittel 526 Mio. USD betrug.
Keine Staats- und Finanzinvestoren
Konsumgüter, Dienstleistungen und der Automotivsektor waren die Hauptziele chinesischer FDIs auf beiden Seiten des Atlantiks, auch wenn Europa traditionell gegenüber den USA breiter aufgestellt ist. Nicht zuletzt weil die Region offener für Investitionen in „kritische“ Sektoren wie Energie und Infrastruktur ist beziehungsweise war. In den Jahren 2014–2017 entfielen immer mehr als 50% der Gesamtinvestitionen auf Staatsbetriebe. Dies hat sich nun deutlich geändert. In diesem „annus horribilis“ der Auslandsinvestitionen näherten sich die chinesischen Staatsinvestments in der EU der Nulllinie. Ebenso sind chinesische Finanzinvestoren nahezu gänzlich verschwunden. Fast alle Investments in der EU wurden durch strategische Investoren getätigt.
2020 wird wieder besser
Die Spezialisten von Baker McKenzie zeigen sich allerdings für das kommende Jahr optimistischer: „Die Deal-Pipeline sieht für 2020 in wichtigen Volkswirtschaften wie Frankreich und Deutschland nach einem relativ ruhigen Jahr 2019 wieder recht gut aus“, kommentiert Thomas Gilles, Leiter der EMEA-China-Gruppe von Baker McKenzie. Dafür gibt es einige Gründe: Unter anderem dank diverser Maßnahmen der chinesischen Zentralbank hat sich die Liquiditätssituation der chinesischen Volkswirtschaft wieder verbessert und die Anleiheaufnahme war solide. Insofern sollte auch mehr Kapital für FDIs zur Verfügung stehen.
Annäherung im Handelskrieg
Sorgten im vergangenen Jahr neue und schärfere Investitionsregeln in der EU und den USA (CFIUS!) noch für Verunsicherung und Zurückhaltung der Investoren, könnte sich nun, da die Regeln bekannt sind, die Risikowahrnehmung der Investoren umkehren und für eine größere Investitionsbereitschaft sorgen. Zumal die Chinesen selbst einiges in Sachen Marktöffnung und -zugangsmöglichkeiten getan haben und so gewissen Ressentiments zumindest teilweise den Wind aus den Segeln genommen haben. Schließlich könnte die Etablierung einer „Phase-1“ im Handelskrieg zwischen den USA und China dafür sorgen, dass man wieder zu einem rationalen Miteinander findet und sich die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Worst-Case-Szenarios zerstreuen. Das nächste „annus horribilis“ der Auslandsinvestitionen köntne somit vermieden werden.




![A6 FotoReisebericht[1] Kopie](https://www.investmentplattformchina.de/wp-content/uploads/2020/02/A6-FotoReisebericht1-Kopie-696x392.jpg)