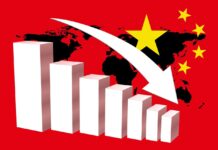New Energy Vehicles als Schlüsselmarkt
Auch bei Fahrzeugen mit alternativem Antrieb, den New Energy Vehicles (NEV), ist Chinas Automobilsektor der größte Absatzmarkt weltweit. Dieser Markt umfasst nicht nur E-Fahrzeuge und Plug-In-Hybride, sondern auch Wasserstoff-Brennstoffzellen, synthetische Kraftstoffe etc. Das Wachstum in diesem Bereich beruht auf gezielten Subventionen durch die chinesische Regierung. Sie sollen sicherstellen, dass Fahrzeuge mit alternativem Antrieb für den Verbraucher im Stadtverkehr erschwinglich sind; zudem wird ein signifikanter Anteil der Käufe durch staatliche Nachfrage gefördert. Seit 2014 wird dieser Sektor in China durch Verkaufsprämien und Steueranreize unterstützt. (Dieses Programm sollte zunächst 2020 auslaufen, wurde jedoch bis 2022 verlängert.)
Das seitens des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) erklärte Ziel ist es, dass NEVs 2025 bereits 20% aller verkauften Fahrzeuge ausmachen sollen. Mit dem massiven Einstieg internationaler OEMs in die E-Mobilität sowie der Konzentration und Kürzung von staatlichen Fördermitteln durch die chinesische Regierung wird eine Neuordnung des Segments erwartet, sodass die Zahl der Start-ups, Hersteller und Zulieferer sinken dürfte. Wir sehen auch hier zahlreiche deutsch-chinesische Kooperationen und Joint Ventures.
„Digital vs. Horse Power“: neue Spannungsfelder mit dynamischen Start-ups und Techgiganten
Ähnlich wie bei den NEVs ist China neben Deutschland auch Vorreiter bei den Intelligent Connected Vehicles (ICVs) mit klaren strategischen Vorgaben. Das Reich der Mitte will im Bereich autonomes Fahren bis 2030 Marktführer sein. Ausländische Investoren werden den chinesischen ICV-Markt nur mit einem chinesischen Partner wie den großen Internetkonzernen Baidu, Alibaba oder Tencent bedienen können. Mit diesem müssen sie gemeinsam in China funktionierende Systeme entwickeln – oder sie müssen ihre eigenen Systeme mit chinesischen Partnern teilen. Prominentes Beispiel ist die von Baidu geführte Plattform Apollo, an der sich mehr als 100 in- und ausländische Unternehmen beteiligen, u.a. auch Daimler, Bosch, Continental und BMW. Die Alternative mag sein, ganz auf in China entwickelte Software zu setzen – aber auch dann wird ein großer Teil der technischen ICV-Infrastruktur von lokalen Unternehmen kommen müssen, die von der Expertise des ausländischen Autoherstellers oder -zulieferers profitieren möchten und natürlich für die Nutzung ihrer Systeme bezahlt werden wollen.
 Regulatorische Beschränkungen
Regulatorische Beschränkungen
Um die regulatorischen Beschränkungen im ICV-Bereich zu verdeutlichen, lassen sich vier Hauptkategorien herausgreifen, die ausländische Unternehmen in Chinas Automobilsektor vor besondere Herausforderungen stellen:
- Value-Added Telecommunications Services (VATS): Der regulatorische Rahmen für alle Arten der elektronischen Kommunikation in China ist komplex und häufig unklar; es bestehen hohe Kapitalanforderungen und strenge Voraussetzungen für die Vergabe von Lizenzen. Insgesamt ist dies ein äußerst sensibler Bereich, in dem ausländische Investoren grundsätzlich keine Mehrheit halten dürfen.
- Navigationssysteme: Der Zugang zu Geodaten in China ist aufgrund nationaler Sicherheitsgesetze streng reguliert, eine Lizenzvergabe erfolgt nur unter harten Auflagen; zentrale Bereiche sind für ausländische Investoren nicht zugänglich, insbesondere auch die eigene Entwicklung elektronischer Navigationssysteme.
- Datenschutz: China hat dazu bereits ein umfangreiches Regelwerk erlassen. Das Sammeln von Daten in China ist vor allem für ausländische Unternehmen streng reguliert; die Übertragung von Daten ins Ausland reguliert das chinesische Cybersecurity Law mit umfangreichen Pflichten.
- Tests im Straßenverkehr: Auch hier bestehen wieder hohe Anforderungen an ausländische Hersteller (u.a. BMW und Daimler mit Lizenz), dies hängt faktisch eng mit den oben genannten Bereichen zusammen.
Fazit
Wir werden auch in Zukunft vielzählige Kooperationen sehen, was stark mit den tief greifenden Veränderungen in der Branche zusammenhängt. Chinas Automobilsektor steht mitten in einer Transformation von der Nutzung traditioneller Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotor hin zu einem Markt, der von Fahrten auf Abruf (Didi Chuxing) dominiert wird. Zudem findet in China ein Wechsel von Verbrennern zu neuen Antrieben wie Elektro- oder auch Wasserstoffmotoren statt, und zwar so schnell wie in keinem anderen großen Markt. Wer hier dabei sein will, wird Partnerschaften eingehen müssen. Und das nicht nur wegen der Kosten und der Komplexität, sondern auch angesichts der regulatorischen Rahmenbedingungen in China.

Thomas Weidlich
Thomas Weidlich, LL.M. (Hull) gehört der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft seit 1996 an. Zwischen 2000 und 2005 hat er das Büro der Kanzlei in Singapur geleitet. Seit 2005 ist er verantwortlicher Partner für die rechtliche Beratung im gesamten Asien-Pazifik-Raum mit Schwerpunkt auf China und Indien. Thomas Weidlich ist ausgewiesener Experte für die Beratung und Koordination von grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen, Joint Ventures, Börsengängen und Restrukturierungen.

Eva König
Eva König, MBA (HfWU Nürtingen) ist Sinologin und Betriebswirtin. Sie hat an den Universitäten Tübingen, Nürtingen, Peking und Xiamen studiert und mehrere Jahre in China gearbeitet. Sie spricht fließend Chinesisch und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung bei Kooperationen zwischen deutschen und chinesischen Partnern. Seit 2019 gehört sie der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft an und unterstützt dort das China Desk bei deutsch-chinesischen Unternehmenstransaktionen.
Dieser Post ist auch verfügbar auf: Vereinfachtes Chinesisch