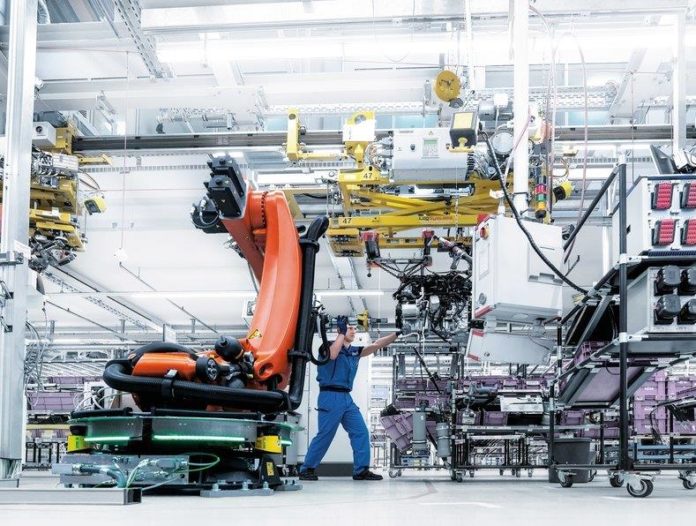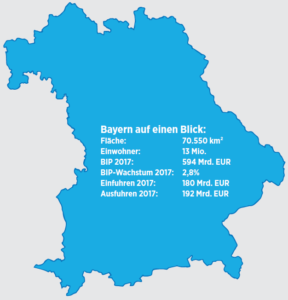Die chinesische „State-owned Assets Supervision and Administration Commission“ (SASAC) beaufsichtigt über 100 Unternehmen im Besitz der chinesischen Zentralregierung. Damit ist die SASAC auch für die Prüfung von Auslandsinvestitionen dieser SOEs zuständig. Insbesondere kontrolliert sie, ob die Investitionen in den grundsätzlichen Investmentfokus des chinesischen Staates passen. Der aktuelle 13. Fünfjahresplan schreibt bekanntermaßen vor, dass die chinesische Wirtschaft in bestimmten Schlüsselindustrien weltweiter Technologieführer werden soll, darunter umweltfreundliche Autos, neue Energiequellen, Energieeffizienz, die Entwicklung neuer Materialien, Biotechnologie und Informationstechnologie. Die Strategie „Made in China 2025“ zielt ergänzend auf ein umfassendes Upgrade der chinesischen Industrie. Auslandsinvestitionen chinesischer Staatsunternehmen in diesen Branchen sind also besonders erwünscht.
Profitabilität gefordert
Im Schatten dieser von offizieller Seite verordneten Strategien hat die SASAC vor einigen Monaten den SOEs unter ihrer Kontrolle eine ergänzende Vorgabe für Auslandsinvestitionen gemacht: Diese müssen ab sofort profitabel sein. Damit reagiert die SASAC auf den Umstand, dass Outbound-Investitionen im Westen in der Vergangenheit sehr oft auf Technologie, starke Marken und Marktzugang ausgerichtet waren, das Thema Profitabilität aber nicht in besonderem Fokus stand. Im Gegenteil: So war es in den vergangenen Jahren nicht unüblich, in Bieterverfahren mit hohen Kaufpreisen und umfangreichen Standort- und Beschäftigungsgarantien das Rennen zu machen.
Dies mit gutem Grund: Denn es war in der letzten Dekade für chinesische Investoren wichtig, den Ruf des „Technologieräubers“ abzuschütteln, der ein Unternehmen im Westen billig kauft, die Fertigung nach China verlagert und hier die Belegschaft entlässt. Dies ist mittlerweile gelungen. Chinesische Investoren haben sich den Ruf erarbeitet, verlässliche Investoren zu sein, die bei ihren ausländischen Beteiligungen nur behutsam Eingriffe vornehmen und dem lokalen Management viel Freiraum lassen.
Verluste addiert
Betriebswirtschaftlich war diese Vorgehensweise mitunter desaströs. So führten insbesondere die umfangreichen Beschäftigungs- und Standortgarantien dazu, dass oftmals dringend notwendige Umstrukturierungen bei den Zielgesellschaften jahrelang verschoben werden mussten. Über die Jahre addierten sich bei einzelnen Übernahmen die Verluste zu dreistelligen Euro-Millionenbeträgen.
Neue Vorgaben
Damit soll jetzt Schluss sein. Was heißt die Vorgabe der SASAC konkret? Die Beteiligungen müssen in der Lage sein, kurz-, mittel- und langfristig positive Erträge zu generieren. Die Betrachtung bleibt dabei nicht bei der obersten Gesellschaft des Targets stehen, sondern bezieht sich auch auf alle Tochtergesellschaften eines erworbenen Konzerns. Für Outbound-M&A-Aktivitäten der von der SASAC kontrollierten SOEs wird daher neben Technologie, Marke und Marktzugang zunehmend auch die tatsächliche Ertragskraft des Targets in den Fokus rücken und nicht nur die während des M&A-Prozesses versprochene Profitabilität.
Frage der Umsetzung
Für Bestandsbeteiligungen heißt das, dass diese umzustrukturieren sind, wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. In der Wahl der Mittel ist der Staatsbetrieb dabei frei. Das heißt, dass die SASAC nicht in die unternehmerischen Entscheidungen der SOEs eingreift, sondern lediglich das Ziel vorgibt. In Betracht kommen also klassische Kostensenkungsprogramme wie zum Beispiel die Zusammenlegung von Standorten und/oder Personalabbau ebenso wie gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, beispielsweise die Verschmelzung einer unprofitablen Konzerngesellschaft mit einer profitablen. Sollten die Maßnahmen nicht greifen, sind die betroffenen Gesellschaften in letzter Konsequenz zu verkaufen oder zu liquidieren.
Weiter reichende Auswirkungen
Was gilt für private chinesische Outbound-Investments und für solche von Staatsunternehmen, die beispielsweise im Besitz von Provinzregierungen stehen? Für diese hat die neue Vorgabe der SASAC zunächst keine unmittelbaren Folgen, denn die Zuständigkeit der SASAC beschränkt sich auf Unternehmen im Besitz der chinesischen Zentralregierung. Allerdings manifestiert sich in neuen Vorgaben dieser Art in der Regel ein grundsätzlicher Wille der chinesischen Staatsregierung. Daher ist davon auszugehen, dass diese Bestimmung jedenfalls reflexiv auch Auswirkungen auf die Entscheidungspraxis der National Development and Reform Commission (NDRC) und der State Administration for Foreign Exchange (SAFE) im Rahmen ihrer M&A-Prüfungsprozesse haben werden. Auch die großen Staatsbanken werden die neue Entscheidungspraxis der SASAC bei der Vergabe von Akquisitionskrediten im Hinterkopf haben.
Fazit
Insgesamt zeigt die neue Vorgabe der SASAC zweierlei. Zum einen ist sie Ausdruck einer – wenngleich angeordneten – Professionalisierung des Beteiligungsmanagements der SOEs. Auch westliche Konzerne würden nicht in nachhaltige Verlustbringer investieren, ohne unmittelbar nach Erwerb oft einschneidende Restrukturierungsmaßnahmen zu ergreifen. Zum anderen dürfte sich durch diese Maßnahme ein Trend verstetigen, der ohnehin schon im Markt zu beobachten war: Chinesische Käufer sind nicht mehr die geborenen Investoren für Distressed M&A Opportunities.
Dieser Beitrag erschien in der Printausgabe 3-2018 der Investment Plattform China/Deutschland.