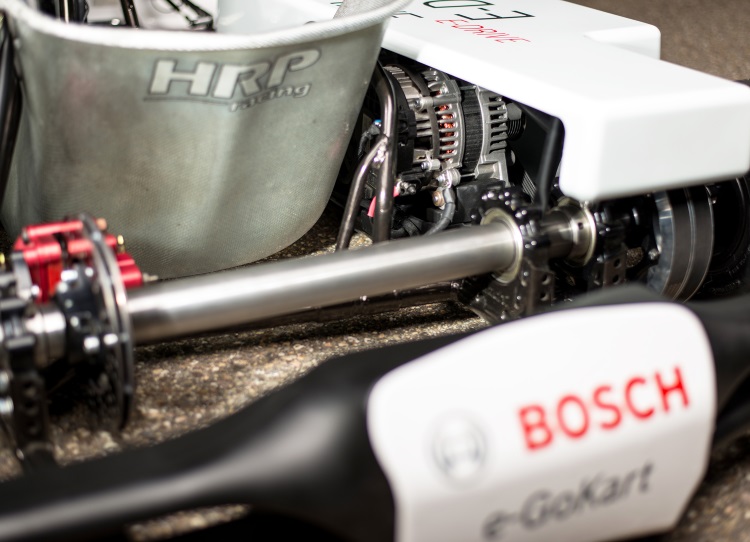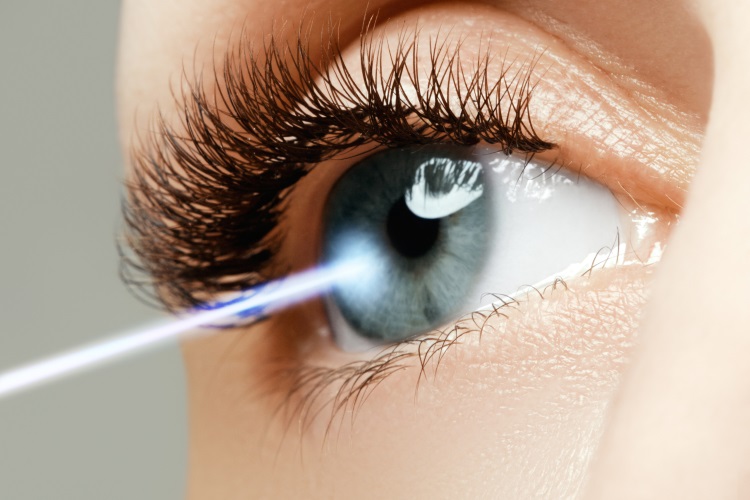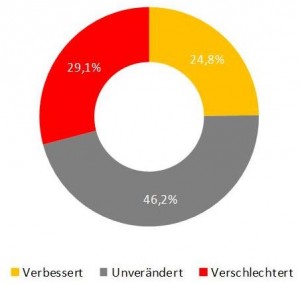Die HNA Group hat ihre Beteiligung an der Deutschen Bank auf 9,9% aufgestockt. Damit ist der Konzern aus Hainan zum größten Anteilseigner an Deutschlands führendem Geldinstitut noch vor dem US-Investmentriesen Blackrock (5,88%) und den beiden Staatsfonds Paramount Services und Premium Services aus Katar (jeweils 3,05%) aufgestiegen. Dies geht aus der jüngsten Meldung der Deutschen Bank zur Aktionärsstruktur mit Stand vom 28. April hervor. Weder die Deutsche Bank noch HNA haben sich bisher darüber hinaus zu weiteren Einzelheiten der jüngsten Anteilserhöhung geäußert. Allerdings hatte die südchinesische Gruppe bereits bei ihrem Einstieg vor knapp drei Monaten durchblicken lassen, die Beteiligung auf bis zu 10% anheben zu wollen.
Im Februar erwarb die HNA Group für geschätzte 755 Mio. EUR einen Anteil in Höhe von 3,04% an der Deutschen Bank. Im Vorfeld der Anfang April abgeschlossenen Kapitalerhöhung des Finanzinstituts hatte HNA die Beteiligung für weitere 425 Mio. EUR auf 4,76% ausgebaut. Ausgehend von einer vollen Ausübung der Bezugsrechte dürfte HNA im Rahmen der Kapitalmaßnahme nochmals rund 380 Mio. EUR in die Hand genommen haben. Für die jüngste Aufstockung bis auf 9,9% hat die Gruppe bei einem Kurs zwischen 16 und 17 EUR in den vergangenen Tagen weitere rund 1,75 Mrd. EUR aufgewendet. Damit hat HNA in der Summe mehr als 3,3 Mrd. EUR in das Finanzinstitut investiert. Sämtliche Transaktionen laufen über den Vermögensverwalter C-Quadrat. Laut Medienberichten soll Alexander Schütz, Gründer und Vorstand der österreichischen Gesellschaft, in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen.
Die HNA Group ist ein Fortune Global 500 Konzern in Privatbesitz, kontrolliert von dem chinesischen Unternehmer CHEN Feng. Das Unternehmen investiert weltweit, vorwiegend in Hotelketten und den Reisesektor. In Europa hat HNA unter anderem Flugzeug-Caterer in Frankreich und der Schweiz übernommen. In Deutschland ist die Akquisition des Regionalflughafens Frankfurt-Hahn nach der Zustimmung des Parlaments des Landes Rheinland-Pfalz so gut wie abgeschlossen. Darüber hinaus ist die Gruppe offensichtlich mit einem indikativen Angebot in das Bieterrennen um die angeschlagene HSH Nordbank eingestiegen. Der Hauptsitz der 1993 gegründeten Gesellschaft befindet sich in Haikou auf der südchinesischen Insel Hainan. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Luftfahrt, Infrastruktur, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Tourismus und Logistik. HNA beschäftigt weltweit insgesamt 410.000 Mitarbeiter. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem mehrere Passagier- und Frachtfluggesellschaften (z.B. Hainan Airlines). 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 30 Mrd. USD.