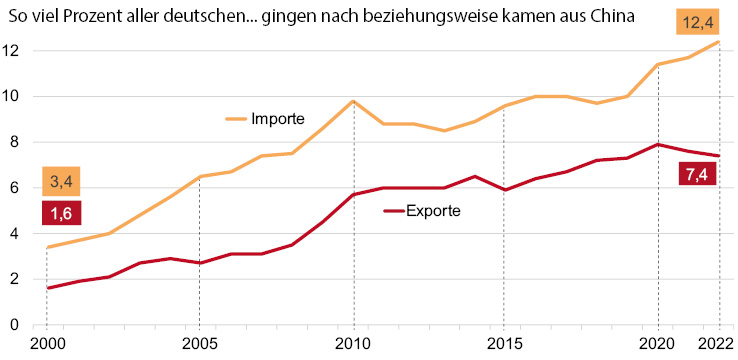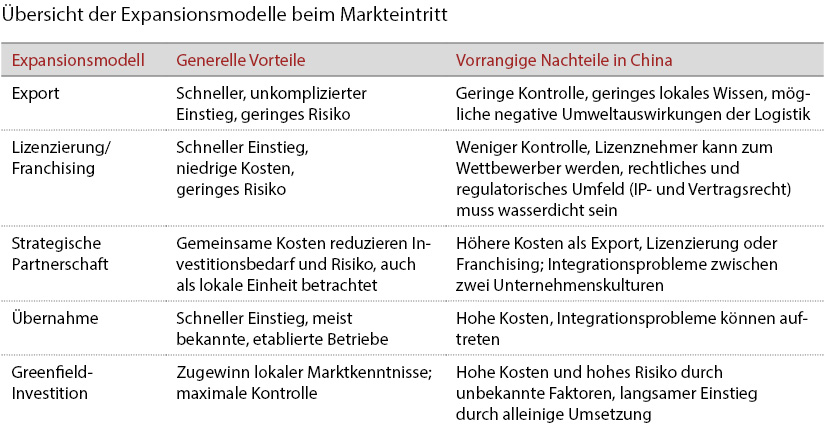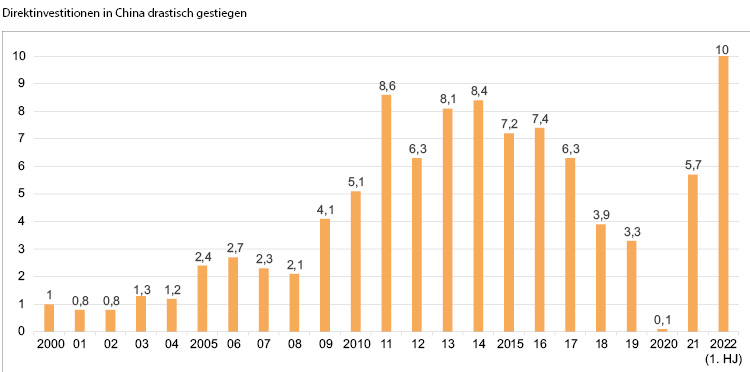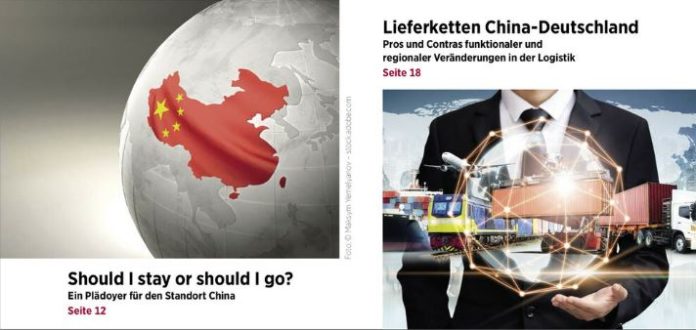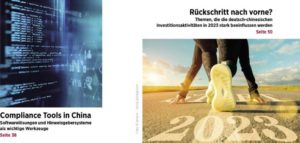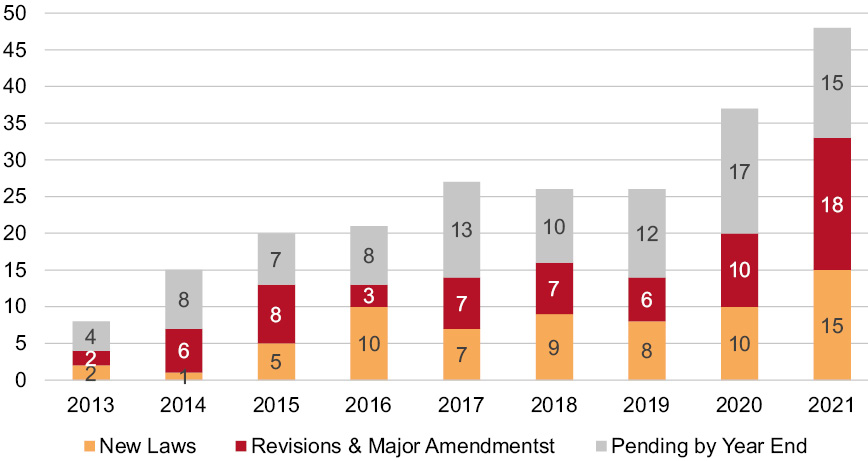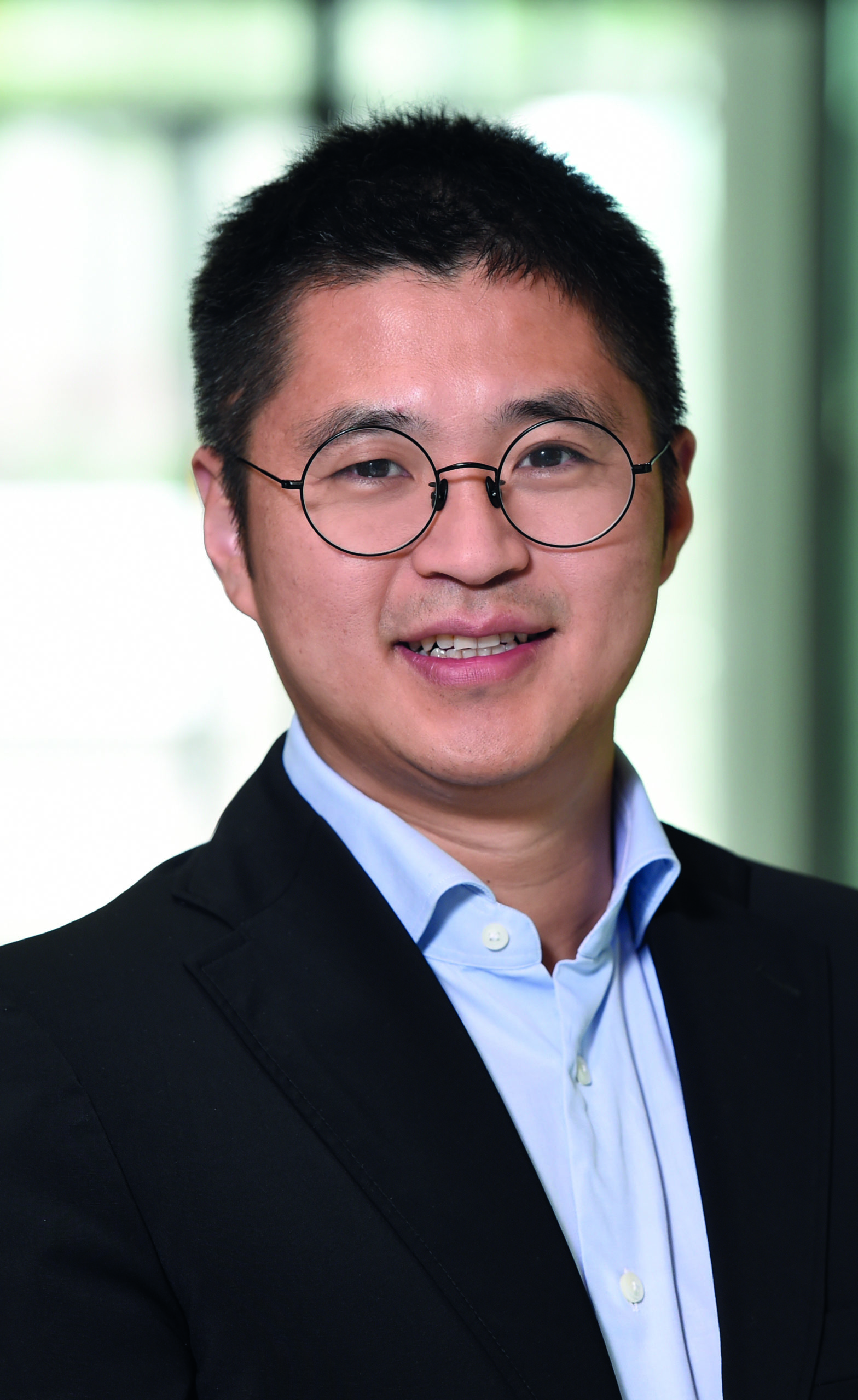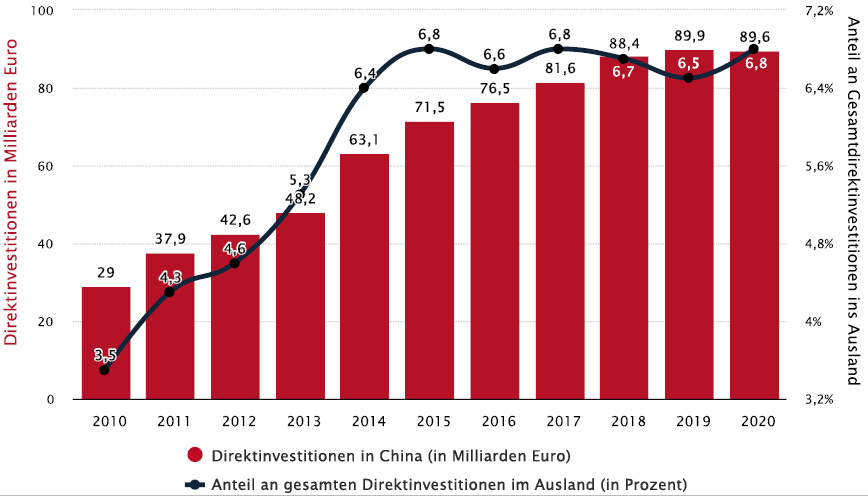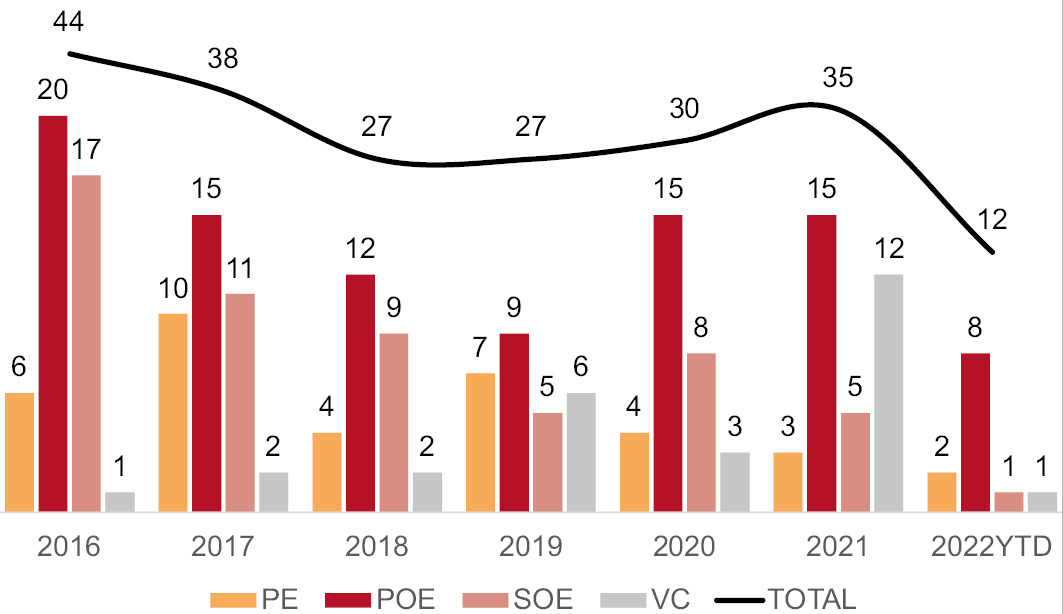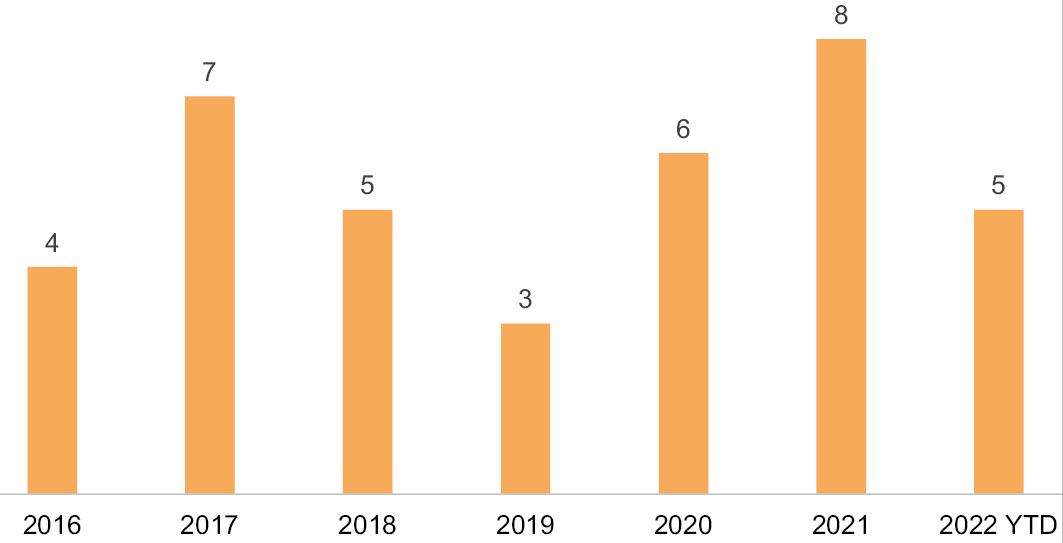In wenigen Tagen wird der Tiger vom Hasen davongejagt. Was so unglaublich klingt, geschieht in der Nacht zum 22. Januar: Das Jahr des Hasen löst das Jahr des Tigers ab.
Hasen sind, so heißt es, talentiert, umsichtig, ehrgeizig, auch elegant. Auf Eleganz lässt sich verzichten, wenn es gelingt, das neue Jahr mit Talent und Ehrgeiz zu gestalten, und umsichtig zu handeln.
Nach dem unerwarteten und abrupten U-Turn in der chinesischen Corona-Politik Anfang Dezember und der kompletten Wieder-Öffnung des Landes 30 Tage später ist die Zeit gekommen, erneut durchzustarten, anzuknüpfen an Altem, sich aber auch dem veränderten internationalen Umfeld zu stellen. Lieferketten müssen wieder funktionieren, der persönliche Austausch muss wichtiger als Video-Calls werden, um Unstimmigkeiten schneller aus dem Weg zu räumen und Gemeinsamkeiten zu finden. Dialog mit – und nicht übereinander – das sollte in den Mittelpunkt gerückt werden. Im Kleinen wie im Großen. Im alltäglichen Geschäft wie in der sogenannten „großen“ Politik. Vertrauen muss wiedergewonnen, Zuversicht gestärkt werden.
So sollten wir, in das Jahr des Hasen startend, zuallererst gegenseitige Schuldzuweisungen hintanstellen. Keinem hilft, den anderen zu belehren, was „wissenschaftlich begründet“ oder was „nicht angemessen“ ist. Dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, auch wenn sie hier und da bereits als endemisch betrachtet wird, sollte allen klar sein. Es bleibt ein Vor und Zurück. Vorkehrungen zu treffen, damit wir nicht wieder im Jahr 2020 landen, ist nur zu selbstverständlich. Überall auf der Welt. Nachdem die Chinesen vergangenes Jahr fast täglich zum PCR-Test „getrieben“ wurden, dürfte es auch keine große Hürde sein, sich vor dem Besteigen eines Flugzeuges testen zu lassen, letzten Endes zur eigenen Sicherheit. Darüber lamentieren – wozu? Ab und an ist es besser, einmal zu schweigen.
Denn entscheidend ist, dass Geschäftsleute wieder zusammenkommen können, ob in China oder Europa. Entscheidend ist, gemeinsam Ideen zu entwickeln, um die Herausforderungen der Zeit zu lösen. Entscheidend ist auch, Strategien zu formulieren, die nicht darauf zielen, einen Konkurrenten auszuschalten. Es muss darum gehen, die Kraft des Wettbewerbs zu nutzen, um Stärken zu stärken, gemeinsam im gemeinsamen Interesse. Politische Entscheidungen, die einschränken, anstatt Kräfte zu entfesseln, schaden nicht nur der Wirtschaft, sondern gefährden auch den gesellschaftlichen Wohlstand. Sogenannte wertebasierte Wirtschafts- und Außenpolitik sollte immer auch berücksichtigen und akzeptieren, dass Werte anderswo anders betrachtet werden.
Globalisierung mag manchem als gescheitert erscheinen, in die Tage gekommen. Doch wer sich oder andere abkoppelt, manövriert sich nur ins Abseits. Die Globalisierung muss auf neue Füße gestellt werden, innovativer werden. Kein exklusiver Club, sondern ein Modell internationalen wirtschaftlichen Handelns, an dem jedes Land partizipiert – und profitiert.
Illusorisch wäre es zu glauben, nach drei Jahren Pandemie dort fortsetzen zu können, wo Ende 2019, Anfang 2020 vieles zum Stillstand gekommen ist. Nein, der Hase muss schon große Sprünge im neuen Jahr machen. Möge er aber nicht zu viele Haken schlagen –damit es ein gutes Jahr wird.
Peter Tichauer ist ausgewiesener China-Experte. Nachdem er mehr als 20 Jahre das Wirtschaftsmagazin ChinaContact aufgebaut und als Chefredakteur geleitet hat, ist er seit 2018 im Deutsch-Chinesischen Ökopark Qingdao (www.sgep-qd.de) für die Kommunikation mit Deutschland verantwortlich.
———————-
Schon unsere brandneue Jahresausgabe ‚Anleihen 2022‘ (11. Jg., Erscheinungstermin Dez 2022) gesehen?
Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.