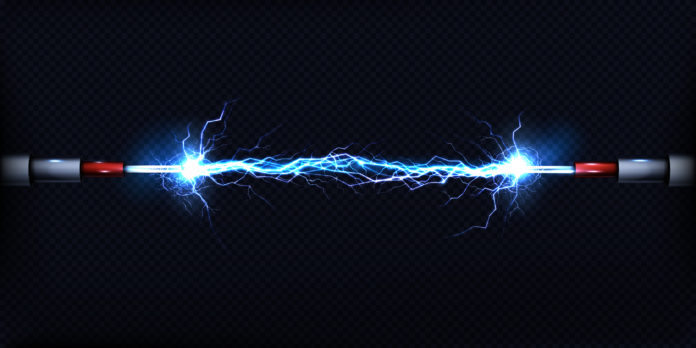Die von der Regierung in China angekündigten Regulierungsmaßnahmen haben in den Medien Sorgen über den fortgesetzten Wachstumskurs des Landes ausgelöst. Die Folge waren starke Reaktionen auf den Aktienmärkten. Hinzu kommen Gerüchte, dass weitere Vorschriften geplant seien, die sich auf zusätzliche Branchen auswirken könnten. Während einige Beobachter die Reformen als Angriff auf bestimmte Branchen, wie die sogenannte New Economy sehen, gehen andere soweit zu sagen, dass China durch den Regulierungswahn „uninvestierbar“ werde. Höchste Zeit also für eine aktuelle Markteinschätzung.
Vor dem Hintergrund gestörter globaler Lieferketten, steigender Inflationstendenzen sowie Regulierungsbemühungen der chinesischen Regierung wachsen zum aktuellen Zeitpunkt auch die Bedenken seitens der Anleger mit Blick auf den Wachstumskurs, der China bisher ausgezeichnet hat. Für uns kommt dieser plötzliche Stimmungsumschwung jedoch überraschend. Viele der neuen Regulierungen dürften nur begrenze Auswirkungen haben – auf Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Essenslieferservice und Internet. Prinzipiell sind die meisten Vorschriften aber nicht mehr als eine Wiederholung früherer Vorschriften. Die Regierung und staatlichen Medien haben sie bereits seit Jahren angekündigt und sogar in den sozialen Medien diskutieren die chinesischen Bürger darüber. Einzig wirklich stark betroffen sind die privaten Nachhilfeinstitute, das sogenannte After School Tutoring, kurz AST.
Bildung: Nachhilfeinstitute stark betroffen
Die Regulierungen für ASTs wurden bereits seit Anfang des Jahres erwartet. Erste Anzeichen waren Vorgaben, den finanziellen Druck durch Studiengebühren zu verringern sowie ein Werbeverbot für AST-Einrichtungen. Die Regierung ist zunehmend der Ansicht, dass die hohen AST-Kosten negative sozioökonomische Auswirkungen haben: Sie verbessern nicht die Gesamtqualität der Bildung, sondern erhöhen den Zeit- und Kostendruck für Eltern und Kinder. Damit senken sie die Geburtenrate und schaffen wirtschaftliche Hindernisse für die soziale Mobilität. Dabei ist die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht in China sehr hoch – ähnlich wie in Japan und Korea. Allen Ländern gemein sind ihr prüfungsbasiertes Bildungssystem und eine Kultur, die Bildung einen hohen Stellenwert zuschreibt. Dieses sozioökonomische Dilemma dürfte daher weiter bestehen. Es ist zu erwarten, dass die Nachhilfeindustrie schrumpfen, aber überleben und sich weiterentwickeln wird. Ein Prozess, den die Regierung weiterhin überwacht und gegebenenfalls mit weiteren Reformen steuern wird.
Vorhersehbare Reaktion auf sozioökonomische Probleme
Einige Experten interpretieren die jüngsten regulatorischen Maßnahmen als eine Art Bestrafung. Sie gilt ihrer Ansicht nach chinesischen Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind. Insbesondere angesichts der Struktur von Variable Interest Entities (VIEs). Sie erleichtert die Offshore-Notierungen in einigen Sektoren und repräsentiert eine Unternehmensstruktur, die die Grundlage für Notierungen in der chinesischen Tech-Branche bildet.
Dass die Risiken für chinesische Unternehmen, die in den USA notiert sind, zunehmen stimmt, aber nicht aufgrund der VIE-Struktur. Denn die meisten der jüngsten regulatorischen Maßnahmen gelten unabhängig vom Ort der Börsennotierung und der Unternehmensstruktur. Somit hat sich das regulatorische Umfeld in China nicht wesentlich verändert. Vielmehr reagiert die Regierung hier auf sozioökonomische Probleme. Je größer eine Branche wird, desto größer werden auch die sozioökonomischen Probleme, die sie mit sich bringt. In der Vergangenheit gab es zahlreiche regulatorische Änderungen, die für andere Sektoren Einschränkungen mit sich gebracht haben. Der springende Punkt ist nun allerdings, dass größere Wachstumsunternehmen und Sektoren betroffen sind, welche häufig von ausländischen Investoren gehalten werden. Entsprechend groß ist ihre Sorge, dass China seinen Wachstumskurs nicht fortsetzt.
Im Vergleich zu anderen Ländern, in denen die Verabschiedung neuer Gesetze und Vorschriften sehr öffentlich und langwierig verlaufen kann, erscheint der chinesische Prozess deutlich intransparenter. Für Anleger bedeutet das, dass sie sich noch intensiver damit auseinandersetzen sollten, um Risiken vorherzusehen. Es ist zu erwarten, dass Unternehmen, die eine dynamische Managementstruktur aufweisen und in der Lage sind, auf die rasch verändernden Rahmenbedingungen zu reagieren, zu den langfristigen Gewinnern zählen werden.
China ist kein Einzelfall
Betrachtet man das Gesamtbild, ist das, was gerade in China passiert, durchaus mit Aktivitäten in anderen Ländern vergleichbar. Medien weltweit berichten seit geraumer Zeit über die „nicht nachhaltigen Praktiken einiger Unternehmen in der sogenannten Gig Economy“ – womit vor allem gemeint ist, dass sie die Wirtschaftlichkeit über das Wohlergehen ihrer Lieferanten und Mitarbeiter stellen. Und Tech Unternehmen stehen auch in Europa und den USA in der Kritik, wobei sogar eine Zerschlagung der Unternehmen ins Spiel gebracht wird. Man denke hier nur an die Auseinandersetzung der Europäischen Union mit globalen bzw. US-amerikanischen Tech-Unternehmen zum Datenschutz.
Potential abseits der „New Economy“
Betrachtet man diese Regulierungsthemen schon sehr lange wird man die neuen Geschäftsmodelle der letzten Jahre mit entsprechender Vorsicht betrachten. Ein gutes Beispiel ist der Essenslieferdienst Meituan. Hier besteht die Sorge, dass die Rentabilität zulasten der Fahrer geht. Man sollte sich daher fragen, wie stabil das künftige Gewinnwachstum angesichts des sozialen Drucks, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern, sein kann. Das Fazit: ziemlich unsicher. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, sich über solche Risikofaktoren Gedanken zu machen, vor allem, wenn man in einem kommunistischen oder zumindest sozialistischen Land investieren will.
Ein Investmentansatz, der ESG-Kriterien vollständig integriert, kann solche sozioökonomischen und politischen Risiken bereits zu Beginn einer Analyse thematisieren. Man muss sich der Regulierungsrisiken absolut bewusst sein – was jedoch nicht bedeutet, dass sie vollständig zu meiden sind. Vielmehr sollte man sie so gut wie möglich in Investmententscheidungen einfließen lassen. Dann wird man sehen, dass es in China auch weiterhin Sektoren auf Wachstumskurs gibt, die man in Betracht ziehen kann. In den letzten Jahren waren das, über den chinesischen Internet-Sektor hinaus, beispielsweise Möbelhersteller oder Unternehmen im Gesundheitswesen, die nicht annähernd unter „New Economy“ fallen.