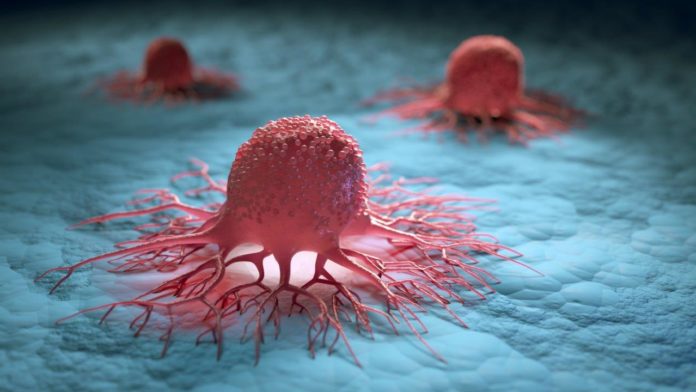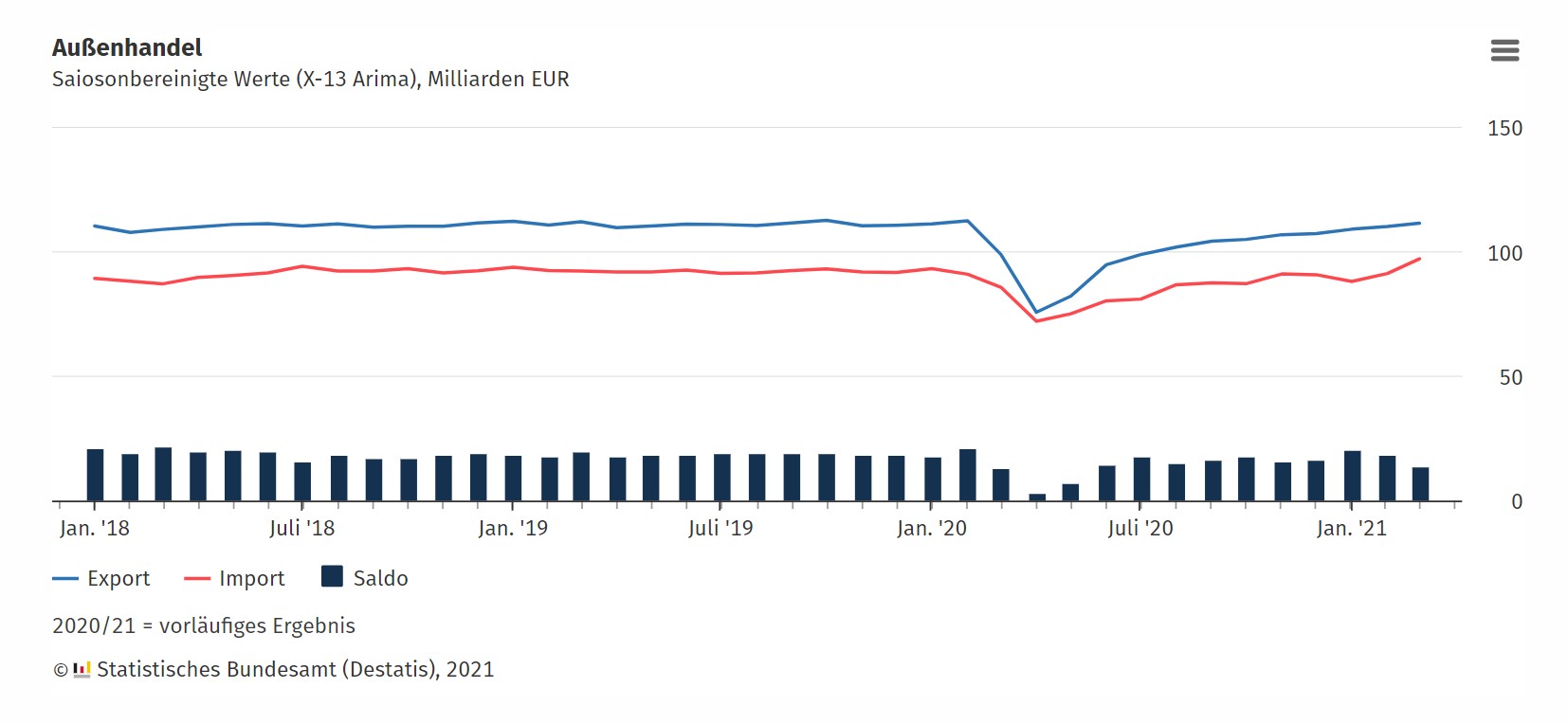Die Schaeffler Gruppe hebt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Hauptgründe sind die allgemeine Erholung des Segments Automotive Technologies und das starke Schaeffler-Wachstum in China.
Die international tätige Schaeffler Gruppe hat ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen zeigt sich mit den Zahlen mehr als zufrieden. So sagte Dr. Klaus Patzak, Finanzvorstand der Schaeffler AG: „Die Schaeffler Gruppe hat im ersten Quartal 2021 ein starkes Ergebnis geliefert. Die strenge Kosten- und Kapitaldisziplin der letzten Monate zahlt sich weiter aus. Aus der deutlichen Belebung der Geschäftsaktivitäten resultierten Skaleneffekte, die einen wesentlichen Beitrag zur starken EBIT-Marge vor Sondereffekten und zur guten Cash Flow Entwicklung geleistet haben.“
Angesichts des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs Anfang 2020 überrascht es nicht, dass Schaeffler ein derart hohes prozentuales Wachstum meldet. Schließlich war die Automobilindustrie mit als erstes von den Umsatzeinbrüchen betroffen. Ein wichtiger Hinweis zur Einordnung der Zahlen, den das Unternehmen auch selbst liefert. Vergleichswerte für das Jahr 2019, die einige Unternehmen wie VW aktuell anbieten, um die Bewertung der Ergebnisse zu erleichtern, liefert Schaeffler aber nicht.
Neue Umsatzprognose dank guter Zahlen
Als Reaktion auf die guten Zahlen hat die Gruppe ihre bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Diese lag bisher bei sieben Prozent; Schaeffler hat aber allein im ersten Quartal 2021 bereits ein Plus von 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. In der Folge geht das Unternehmen jetzt davon aus, dass das währungsbereinigte Umsatzwachstum bei über 10 Prozent liegen wird.
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: „Das starke erste Quartal 2021 versetzt uns in die Lage, unsere Prognose für das laufende Jahr 2021 trotz der bestehenden Unwägbarkeiten nach oben anzupassen. Dabei hilft uns, dass die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen Wirkung zeigen. Trotz der Erholungstendenzen bleiben wir weiter vorsichtig. Mit unserer Roadmap 2025 sind wir strategisch gut aufgestellt, um Wachstumspotentiale in Zukunftsfeldern zu realisieren.“
Interessant ist, dass die Umsätze sich in den einzelnen Berichtsregionen sehr unterschiedlich entwickelt haben. In Europa liegen sie mit -0,6 Prozent noch knapp unter den Zahlen aus 2020, während die anderen Regionen alle positive Wachstumsraten melden. So liegt das Wachstum in der Region Americas bei 6,7 Prozent und in der Region APAC bei 12,2 Prozent. Spitzenreiter ist „Greater China“ mit 57,1 Prozent.
Hierbei ist wiederum zu beachten, dass China früher von der Umsatzkrise erfasst wurde – und sich schneller erholte – als andere Regionen. Nicht nur für Schaeffler gilt daher, dass die Vergleichswerte des zweiten Quartals 2021 in Europa und den anderen Regionen ebenfalls wieder höher ausfallen dürften.
China trägt Schaeffler-Umsatz
Davon unabhängig sind die Zahlen aus der Volksrepublik in jedem Fall beeindruckend. So weist das Schaeffler-Segment Automotive Technologies in China ein Wachstum von 74,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Da das Segment weltweit ein vergleichsweise niedriges Wachstum von 15,8 Prozent erzielt hat, zeigt sich welche Bedeutung der Markt in China mittlerweile für Schaeffler hat.
Ähnlich ist die Entwicklung im Bereich Automotive Aftermarket. Auch hier liegt China mit einem Wachstum von 73,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020 weltweit vorne. Aus Europa meldet Schaeffler im gleichen Zeitraum einen Umsatzrückgang von 3,1 Prozent. Das Gesamtwachstum des Segments lag bei 4,0 Prozent
Damit liegt es praktisch gleichauf mit der Sparte Industrial, die ein Wachstum von 3,9 Prozent erzielte. Die Sparte Industrial trägt mit zuletzt 836 Mio. EUR allerdings fast das Doppelte zum Schaeffler-Umsatz bei wie Automotive Aftermarket (444 Mio. EUR).