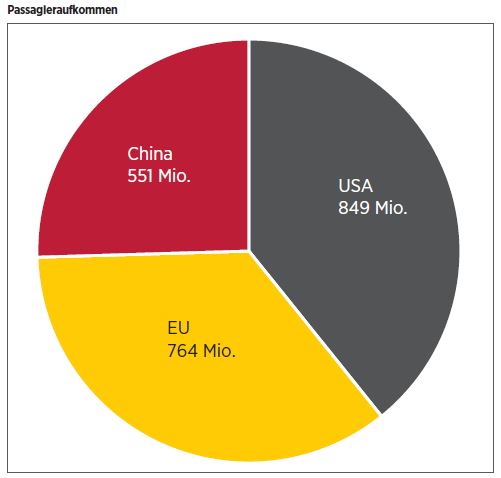Die Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) erwarb 5% des Stammkapitals der Daimler AG und wird damit drittgrößter Einzelaktionär bei den Stuttgartern
Über die Tochterfirma Investment Global erwarb BAIC 2,48% der Anteile von Daimler und sicherte sich eine Option auf weitere 2,52%. Daimler selbst ist an der BAIC-Tochter BAIC Motor, der PKW-Sparte des Pekinger Konzerns, mit 12% beteiligt. Insofern ist BAIC kein Unbekannter für den deutschen Premium-Hersteller und eine Überkreuzbeteiligung war wohl schon länger im Gespräch.
Entsprechend erfreut zeigte sich der Vorstandsvorsitzende bei Daimler, Ola Källenius: „Wir begrüßen es sehr, dass unser langjähriger Partner BAIC nun auch ein langfristig orientierter Investor von Daimler ist.“ Damit werden beim Dax-Konzern sehr viel herzlichere Tönen angeschlagen als gegenüber dem Einstieg von Geely-Eigner Shufu Li im Februar 2018. Li ist seitdem größter Einzelaktionär von Daimler. Die Beteiligung Lis kam überraschend und wurde damals von Daimler eher zurückhaltend kommentiert. Bei allen Kooperationen mit Geely seitdem hatte man stets auch immer im Hinterkopf, die Interessen des Staatsunternehmens und alten Partners BAIC nicht zu verletzen. Nicht zuletzt, weil man gemeinsam mit BAIC in China fertigt. Rund drei Viertel des Gesamtabsatzes in China werden in einem gemeinsamen Joint Venture produziert – etwa 485.000 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr gefertigt.
Der Einstieg von BAIC beweist, dass diese bedächtige Strategie richtig war. Schließlich kommt die Beteiligung der Pekinger für Daimler zur rechten Zeit. Nach einer deutlichen Gewinnwarnung und einem satten operativen Verlust von 1,6 Mrd. EUR im vergangenen Quartal stand der Konzern zuletzt an der Börse deutlich unter Druck. Verstärkt wurde dieser noch durch neue Details aus dem alle deutschen Automobilkonzerne betreffenden Dieselskandal sowie einem erweiterten Rückruf der Takata-Airbags. Mit dem alten Partner als neuem Teilhaber wächst nun wieder die Kursphantasie – die Papiere von Daimler schlossen am Tag der Meldung mit fast 5% im Plus. Dennoch bleibt Daimler an der Börse äußerst günstig bewertet.
Mittelfristig wird es spannend zu sein, zu sehen, wie Geely und BAIC, die eigentlich Konkurrenten sind und nun gemeinsam rund 15% des Daimlerkonzerns halten, bei der deutschen Premiummarke agieren. Einerseits gilt es zu verhindern, dass die chinesischen Teilhaber Projekte des jeweils anderen behindern oder gar blockieren und so am Ende Daimler schaden und zeitgleich müssen die Schwaben aufpassen, nicht in eine chinesische „Zange“ zu geraten und zu chinesisch zu werden. Andererseits aber hat China für Daimler auch eine herausragende Bedeutung: Rund 30% ihrer Autos verkaufen die Schwaben im Reich der Mitte. Insofern kann die nun doppelte chinesische Beteiligung auch äußerst vielversprechend und befruchtend sein.